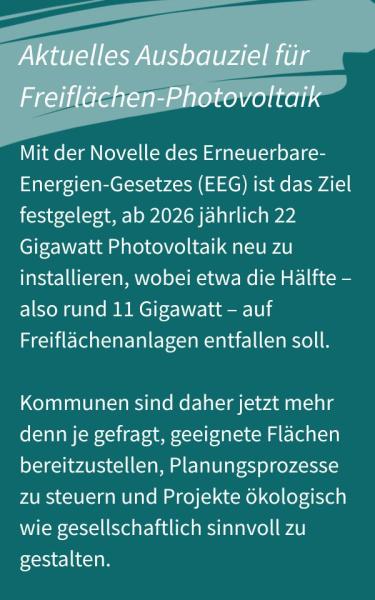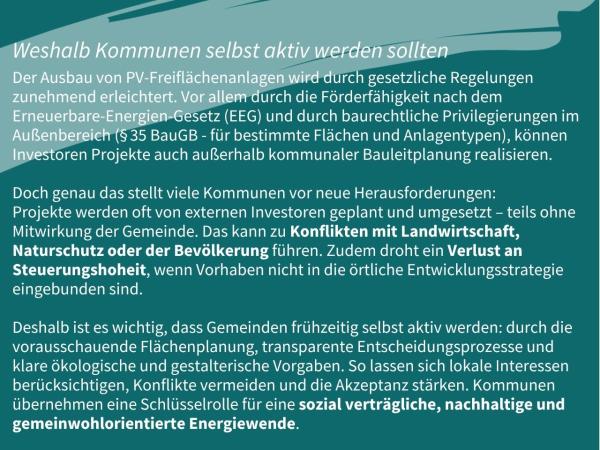Rechtlicher Rahmen und Planungshoheit
Die wichtigsten Weichen werden im Flächennutzungsplan und Bebauungsplan gestellt. Bei der Ausweisung geeigneter Flächen für Solarparks hat die Kommune die zentrale Planungshoheit. Es wird grundsätzlich zwischen zwei Flächentypen unterschieden:
Privilegierte Flächen: Dazu zählen beispielsweise Streifen entlang von Autobahnen (bis 200m Entfernung) und mehrgleisigen Schienenwegen oder Flächen unmittelbar an landwirtschaftlichen Höfen. Für diese Flächen kann das aufwändige Bebauungsplanverfahren entfallen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Sind die Flächen privilegiert und stehen dem Vorhaben keine öffentlichen Belange (Naturschutz, Landschaftsbild etc.) entgegen, genügt ein Bauantrag, um das Projekt umzusetzen.
Nicht-privilegierte Flächen: Für alle übrigen Freiflächen – insbesondere Ackerflächen, Grünland oder naturnahe Areale – ist ein vollständiges Bebauungsplanverfahren erforderlich, inklusive Umweltprüfung. Dies betrifft vor allem Ackerflächen oder Grünland. Hier hat die Kommune die volle Planungshoheit und kann über die Gestaltung, den Umfang und die ökologische Ausrichtung des Projekts entscheiden.
Standortauswahl und Flächenmanagement
Eine sorgfältige Standortwahl ist entscheidend für den Projekterfolg. Besonders geeignet sind vorbelastete oder minderwertige Flächen, wie ehemalige Deponien, Altstandorte und Konversionsflächen, Brachflächen oder Bereiche entlang von Infrastrukturen (Straßen, Bahnlinien) wie hier in Neusitz. Die ökologischen und gesellschaftlichen Vorteile solcher Standorte sind die Minimierung von Nutzungskonflikten, z. B. mit Landwirtschaft, Tourismus oder Naherholung sowie die ökologische Aufwertung von bisher ungenutzten oder degradierten Flächen.
Naturverträgliche Gestaltung und Artenschutz
Wenn PV-Freiflächenanlagen ökologisch durchdacht geplant und betrieben werden, können sie wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen schaffen. Die Gemeinden können hierzu Festsetzung im Bebauungsplan und Vertragsgestaltung konkrete Anforderungen festlegen. Mögliche Maßnahmen sind:
- Schafbeweidung zur natürlichen Pflege der Flächen,
- Anlage von heimischen, insektenfreundlichen Blühstreifen,
- Offenhaltung von Wildtierkorridoren und Abstand zwischen Modulen
- Durchlässige Zäune für Kleintiere,
- Verzicht auf Pestizide und Dünger,
- Schaffung von Rückzugsflächen für bedrohte Arten.
„Naturschutz und erneuerbare Energien können und müssen gemeinsam gedacht werden“, Andreas Engl, Betreiber eines Freiflächensolarfeldes."
Gute Beispiele für solche Kriterien gibt es bereits einige, sowohl für die Standortwahl als auch für die Gestaltung von Anlagen. Empfehlenswert ist der Leitfaden des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende (KNE), der konkrete Vorschläge zur naturverträglichen Planung von Solarparks enthält.
Beteiligung und Kommunikation
Für die gesellschaftliche Akzeptanz ist es entscheidend, die lokale Bevölkerung frühzeitig und transparent einzubinden. Gute Ansätze sind:
- Bürgerinnen und Bürger frühzeitig über Ziele, Chancen und Auswirkungen informieren,
- Beteiligungsformate wie Bürgerversammlungen, Feedbackmöglichkeiten oder Infoplattformen,
- Bürgerbeteiligungsmodelle (z. B. finanzielle Teilhabe an Pacht- oder Stromeinnahmen)
- Kooperationen mit Energiegenossenschaften.
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Vorteile
- Pachteinnahmen für gemeindeeigene oder private Grundstückseigentümer,
- Steuereinnahmen (Kommunalabgabe, Gewerbesteuer),
- Potenzial für lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze (z.B. Pflege, Bau, Wartung),
- Möglichkeiten zur Gründung kommunaler Energiegesellschaften mit direkter Beteiligung an den Projekten.